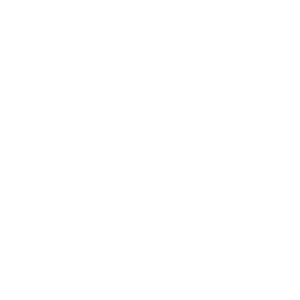BU – Begleiteter Umgang

„Begleiteter Umgang“ (BU) ist eine rechtlich kodifizierte und in der Regel zeitlich befristete Anspruchsleistung der Jugendhilfe mit dem Ziel, die Beziehung eines Kindes zu dem Elternteil zu fördern, mit dem es nicht zusammenlebt.
Im Mittelpunkt steht das Recht des Kindes auf Umgang mit beiden Eltern nach Elterntrennung. Kindeswohl und Kindeswille sind die Richtschnur bei allen Regelungen zum Umgangsrecht.
Ziele
- dem Kind die Gelegenheit zu geben, seinen Platz im Familiensystem zu finden.
- das Bewusstsein dafür zu schärfen, ob Kontakte als übermäßig belastend empfunden und ausgesetzt werden müssen.
- die unterschiedlichen Familienformen mit den verschiedenen ethnischen-kulturellen Hintergründen sensibel zu berücksichtigen und flexibel in den Umgang einzubauen.
- fallspezifische Reflexionen durchzuführen, um weitere Unterstützungsangebote zu prüfen.
- die zeitnahe Abwicklung der Leistung, die Grundlagen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII) zu kennen und mit einer zertifizierten Fachkraft der Einrichtung zusammen zu arbeiten.
- Eskalationen zwischen Elternteilen zu vermeiden und vermittelnd zu intervenieren und zu steuern.
Rechtliche Rahmenbedingungen
- § 1626 Abs. 3 Satz 1 BGB: Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen
- § 1626 Abs. 3 Satz 2 BGB; § 1685: Umgangsberechtigter Personenkreis ist ausgeweitet auf Großeltern, Geschwister, Stiefelternteile und Pflegepersonen
- § 1684 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BGB: Das Familiengericht darf den begleiteten Umgang anordnen.
Methodisches
Die Interaktionen zwischen Kind und umgangsberechtigtem Elternteil wird an einem neutralen Ort ermöglicht. Die Umgangsbegleitung nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:
- Begleitung der Übergabe des Kindes
- Begleitung des Zusammenseins von Kind und umgangsberechtigtem Elternteil
- Gewährung eines sicheren Ablaufs
- Dokumentation des BU
- Rückmeldung und Kooperation
Die Begleitintensität richtet sich nach dem Belastungs- und Risikopotential. Für einen Videoeinsatz und dessen Auswertung sprechen folgende Gründe:
- Der direkte Eltern-Kind-Kontakt kann reflektiert werden.
- Es gibt eine zweite Beobachtungsebene.
- Belastungssituationen des Kindes können durch mehrfaches Sichten besser erkannt werden.
- Videomaterial kann positives oder negatives Beweismittel sein.
Die Dokumentation per Videoaufnahmen ist nur mit Einwilligung aller Betroffenen möglich.